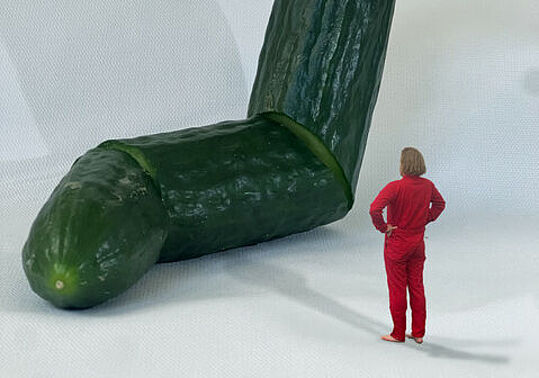Gemeinsam Sicherheit schaffen
Yoga als sogenannter „Safe Space“ für dicke Körper, Firmen, die ihre Arbeitsplätze als Safe Space bewerben und Clubs, die Safe Space-Partys mit dem Ziel veranstalten, dass Menschen hier risikolos sie selbst sein können: Das Konzept von sicheren Räumen ist in der breiten Gesellschaft angekommen – als Lippenbekenntnis und als Marketingkonzept. Die ursprüngliche und für Minderheitengruppen überaus relevante Bedeutung von Safe Spaces geht hierbei oft verloren.
SafeR Spaces
„Safe Spaces“ waren in den 1960er-Jahren in den USA ein Versuch queerer Bewegungen, Räume zu schaffen, in denen queere Menschen sich über die gesellschaftlichen Diskriminierungen aufgrund ihres Begehrens austauschen und organisieren konnten. Es ging dabei explizit um die Auseinandersetzung mit Diskriminierungsformen und ein Finden von Lösungen. Das Mitbedenken von Bedingungen für Sicherheit, unterschiedlichen Vulnerabilitäten, Definitionsmacht und verschiedenen Ideen von Sicherheit war und ist dabei von großer Relevanz. Denn die queere Geschichtsschreibung seither lehrt, dass es Safe Spaces nicht gibt. In einer vom binären Hetero-Patriarchat und neoliberalen Kapitalismus geprägten Gesellschaft, die auf Prekarität, Ausbeutung und Widersprüchen basiert, gibt es keine Sicherheit – für generell kein Subjekt, für Minderheitengruppen aber nochmal weniger. Da wir alle als Menschen in sexistischen, rassistischen und weiteren diskriminierenden Verhältnissen sozialisiert werden, kann es gar keinen Raum geben, wo wir diese Verhältnisse nicht reproduzieren. Anstatt „Safe Space“ wird deshalb in queeren Kreisen mittlerweile das Konzept von „Safer Space“ verwendet, um aufzuzeigen, dass der jeweilige Raum zwar sicherer ist als die Durchschnittsgesellschaft, allerdings erstens nicht für alle gleich sicher und zweitens nie komplett sicher, für niemanden.
Partizipation und Verantwortlichkeit
Wer ernsthaftes Interesse daran hat, einen Safer Space herzustellen, muss sich deshalb auch immer der Verantwortung bewusst sein, die damit einhergeht. Anstatt „Safe Space“ gedankenlos als wokes Label zu verwenden, das im Lichte von neoliberal vereinnahmten Diversity-Vorstellungen gerade in ist, sollte sorgfältig überlegt werden, wie denn ein sichererer Raum für den jeweiligen Kontext überhaupt hergestellt werden kann. Die Performance-Reihe „PAM PAM CLUB: Queer Erotica Night Vienna“ gehostet von Natalie Ananda Assmann und Denise Kottlett in Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Künstler_innen und Akteur_innen aus der Szene wie Nora Aaron Scherer oder Damien Thorn, nimmt sich dieser Herausforderung an. So versucht das Event, das „by sweethearts from the community for sweethearts from the community” organisiert wird und am 24.02.2024 im WUK stattfindet, mit einem performativen, künstlerischen und vor allem partizipativen Zugang, Berührungspunkte mit queerer Erotik zu schaffen. Im Gespräch beschreibt Natalie Assmann, wie die Veranstalter_innen den Abend zu einem Safer Space machen wollen. Anstatt mit starren Identitätskategorien arbeiten sie mit einer konkreten und transparenten Einladungspolitik sowie der Gestaltung des Raumes und kollektiver Verantwortlichkeit. Denn die gelebte Praxis zeigt, dass FLINTA (Frauen, Lesben, inter, nichtbinär, trans, agender)-Räume, deren Inklusionspolitik über die geschlechtliche Identität läuft, erstens nicht frei von hetero-patriarchalen Strukturen sind und zweitens ebenfalls Unsicherheiten und Ausschlüsse produzieren. In vielen FLINTA-Räumen sind vorwiegend cis-Frauen zu finden, während beispielsweise transmaskulin auftretende Personen sich nicht eingeladen, wohl oder überhaupt gesehen fühlen. Wenn stattdessen in Veranstaltungseinladungen konkrete unterschiedliche Erfahrungen und Betroffenheiten mitgedacht werden, kann das Menschen Sicherheit vermitteln, sich in Räume zu trauen beziehungsweise ihnen eine Idee davon geben, ob sie in diesen Räumen erwünscht sind oder nicht.

Natürlich fordert das Mitbedenken von unterschiedlichen Diskriminierungsverhältnissen viele Kapazitäten und kreative Lösungsansätze, insbesondere bei breiten Einladungspolitiken wie sie auch der PAM PAM Club vertritt. Hier wird beispielsweise mit queerem, sensiblem Personal an der Bar und der Tür gearbeitet sowie mit einer Veranstaltungseinladung, die explizit die queere Community anspricht, außerdem auch mit einem Veranstaltungsort, der bereits oft queere Veranstaltungen gehostet hat und mit diesen Anforderungen umgehen kann. Außerdem wird die Anzahl der Gäste eher geringgehalten, damit die Hierarchie zwischen Performer_innen und Publikum etwas verschwimmt und Menschen die Möglichkeit haben, zu partizipieren, sich auszudrücken, zu kommunizieren und somit auch kollektiv Verantwortung für den Abend zu tragen. So ein Format benötigt eine große Prise Vertrauensvorschuss und Wohlwollen. Vielleicht ist aber genau das eine produktive Idee, um Inklusion und Exklusion über fixierte Identitätszuschreibungen hinaus zu verhandeln.
Miteinander lernen
Die Philosophin Eve Kosofsky Sedgwick schreibt über eine umfassende Skepsis vor einander auch innerhalb feministischer Bewegungen, da wir aufgrund unserer Diskriminierungserfahrungen gelernt haben, immer auf der Hut zu sein. Sie begegnet dieser nicht immer produktiven Skepsis mit dem Konzept des „reparativen Lesens“, das nicht bei einer Kritik aneinander und an den Verhältnissen stehenbleibt, sondern darauf aufbauend versucht, Ideen für Verbesserungen zu schaffen. Auch die US-amerikanische Autorin bell hooks plädiert in ihrem Konzept einer „engagierten Pädagogik“ für die Möglichkeit, gemeinsam schädliche Strukturen, Dynamiken und Privilegien zu verlernen und neue Verhaltensweisen zu erlernen. Beide Konzepte entstehen auf der Basis von Empathie, gelebter Solidarität und der Bereitschaft, aufeinander einzugehen. Natürlich reicht Empathie alleine nicht für Veränderung aus. Die Handlungsmacht von Individuen und Gruppen endet immer irgendwo und manche strukturellen Ungleichheitsverhältnisse müssen anders angegriffen werden. Nicht jeder Kontext hat außerdem den Anspruch oder Zweck, dass Menschen hier miteinander lernen und manchmal braucht es radikalere Einladungspolitiken, um ein gewisses Niveau von Sicherheit zu gewährleisten. Genauso gibt es aber auch Räume, in denen wir unsere Handlungsfähigkeit gemeinsam radikal zärtlich nutzen können, um die Ambivalenz von Öffnung und Sicherheit immer wieder neu zu verhandeln.
Verena Kettner lebt und arbeitet in Wien als Politikwissenschaftler_in und Redakteur_in für das feministische Magazin an.schläge.

Was heißt eigentlich „offen“? Ist Offenheit ein Gut?
Wir wollen offen sein, Offenheit zum Thema machen, infrage stellen, umsetzen - barrierefrei, niederschwellig, vermittelnd.
Wer kann unter welchen Bedingungen an Kunst und Kultur teilhaben? Und wer bleibt aufgrund von strukturellen Schwellen außen vor? Was ist notwendig, um eine möglichst breite Teilhabe zu gewährleisten?