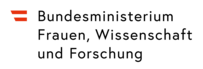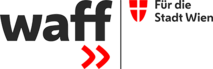Demokratiebildung und Wahlausschluss – Wie geht das zusammen?
Lesezeit: ca. 5 Minuten
Viele der jungen Erwachsenen im Pflichtschulabschlusskurs von WUK m.power sind Asyl- oder subsidiär Schutzberechtigte, die bisher neben Deutschkursen vor allem in verpflichtenden Orientierungs- und Wertekursen des Österreichischen Integrationsfonds mit Demokratiebildung in Berührung kamen. Ist dort vor allem eine frontale Vermittlung von Wertehaltungen das Ziel, verfolgt WUK m.power die Absicht, mit den Teilnehmer*innen auf Augenhöhe ins Gespräch zu kommen.
Fragt man eine Runde von Jugendlichen, was eine Demokratie denn im Kern ausmacht, so kommt schnell die Antwort, dass es hier zentral um die Mitbestimmung aller geht. Dieser wichtige demokratische Grundpfeiler wird in manchen Klassenverbänden wohl unhinterfragt hingenommen und die Aufzählung geht flott mit Meinungsfreiheit, Menschenrechten oder anderen Begriffen weiter. In heterogenen Gruppen wie bei WUK m.power, in denen Schüler*innen mit unterschiedlichsten Herkünften und Staatsbürgerschaften sitzen, kommen aber schnell Einwände auf. Denn bei Weitem nicht alle dürfen wählen, auch wenn viele in Österreich geboren sind oder bereits seit ihrer Kindheit hier leben.
Diese Problematik ist besonders in Wien stark ausgeprägt, wo von rund 100.000 Jugendlichen, die seit der letzten Gemeinderatswahl 2020 das Wahlalter erreicht haben, nur zwei Drittel tatsächlich am 27. April ihr Kreuz machen dürfen. Im Pflichtschulabschlusskurs, in dem junge Erwachsene ab 16 Jahren ihren Abschluss nachholen, ist die Situation noch drastischer. So waren bei WUK m.power in den vergangenen Jahren im Schnitt nur ein Viertel der Teilnehmer*innen in Österreich wahlberechtigt. Wie also mit Jugendlichen über Demokratie sprechen, die zum großen Teil von Wahlen ausgeschlossen sind?
Das sichtbar zu machen und unterschiedlichen Perspektiven und Erfahrungen Raum zu geben, ist daher ein gewinnbringender Ansatz für alle. „Unser Ziel ist es, Demokratie nicht nur zu erklären, sondern mit den Teilnehmer*innen gemeinsam darüber zu sprechen und zu diskutieren. Sie teilen dann gerne ihre Erfahrungen, z.B. erklärt jemand aus dem Iran, warum freie Meinungsäußerung wichtig ist, oder jemand aus Afghanistan spricht darüber, warum auch Mädchen in die Schule gehen sollen“, erläutert Milena Merkač.
Generell ist die Zuversicht für veränderte Bedingungen und mehr Mitspracherecht bei den Jugendlichen aber leider gering. Desire, der in Österreich geboren ist und bei WUK m.power seinen Abschluss nachholt, kritisiert: „Für mich ist es sinnlos und langweilig, über die österreichischen Parteien etwas zu lernen, wenn ich dann sowieso nicht wählen darf. Ich glaube leider auch nicht, dass sich die Gesetze da bald ändern werden.“
Bei all den Versuchen, die Breite an Möglichkeiten aufzuzeigen, um sich Gehör zu verschaffen, bleiben bis zum Schluss der Widerspruch und die Ungerechtigkeit bestehen, die sich durch den Wahlausschluss einer großen Gruppe von Menschen ergeben. Das kann nicht beschönigt oder wegdiskutiert werden. Es auszuhalten und dabei trotzdem Alternativen zu thematisieren, ist das Spannungsfeld, in dem sich diese wichtige pädagogische Praxis abspielt.
Text: Angela Tiefenthaler ist in der Leitung des Pflichtschulabschlusskurses WUK m.power tätig und unterrichtete zuvor jahrelang das Fach „Deutsch, Kommunikation und Gesellschaft“.